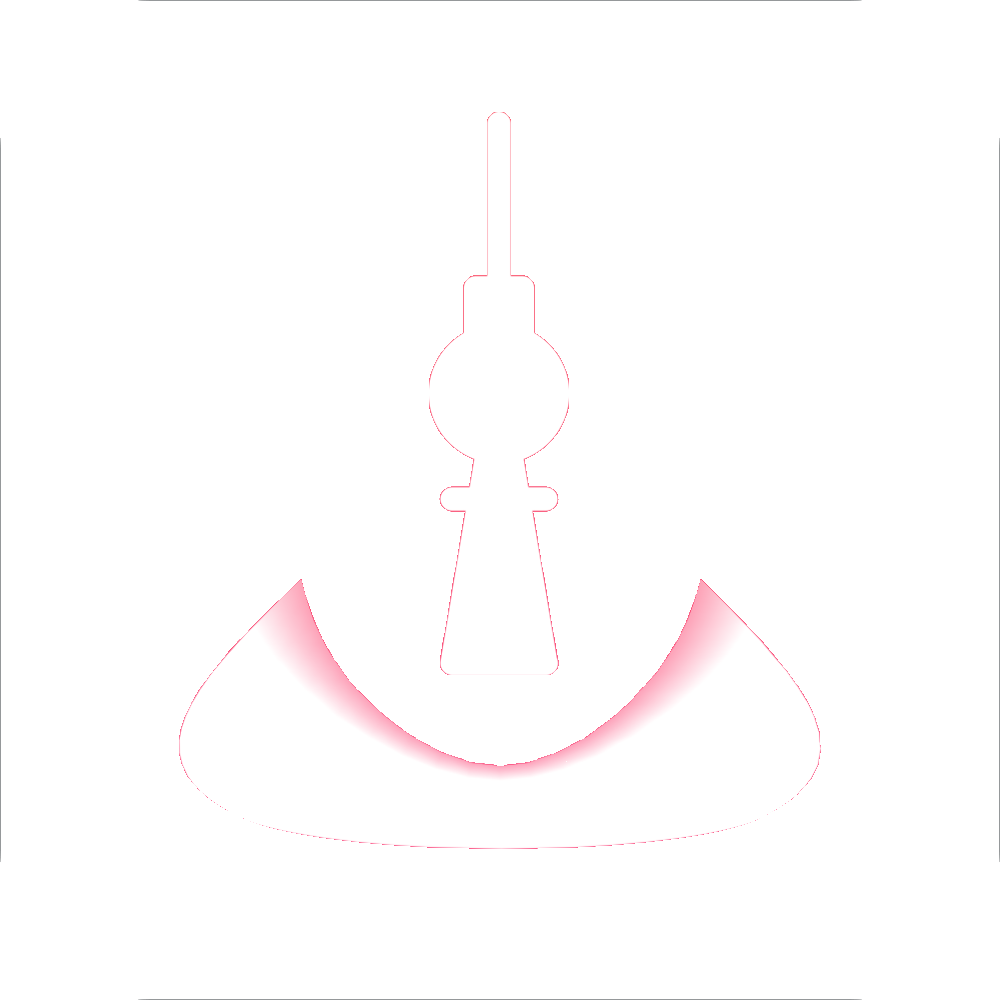Kultur in der Hauptstadt
von Michael Bienert
(Auszüge us Berlin für junge Leute))
Themen: Und der Haifisch, der hat Zähne | Magnet Berlin | Netzwerke, Plattformen, Off-Szene | Weltkultur und Migration | Festival das ganze Jahr | Literaturszene | Musikalische Leuchttürme | Theater | Kultur- und Museumspolitik | Ein Schloss für die Welt
Und der Haifisch, der hat Zähne
„Berlin ist eine wundervolle Angelegenheit, kannst du nirgends 500 Mark stehlen und kommen? Alles ist überfüllt von Geschmacklosigkeiten, aber in was für einem Format, Kind!“, schreibt der junge Bertolt Brecht im kalten Februar 1920 an seinen Freund Caspar Neher in Augsburg. Kurz nach seinem 22. Geburtstag ist Brecht zum ersten Mal in die Hauptstadt gereist und berauscht von den Menschenmassen, der U-Bahn, den Kaufhäusern, dem Kulturleben: „Der Schwindel Berlin unterscheidet sich von allen andern Schwindeln durch seine schamlose Großartigkeit. Die Theater sind wundervoll: Sie gebären mit hinreißender Verve kleine Blasensteine. Ich liebe Berlin, aber m. b. H.“
Brecht, der seinen Freunden freche Verse zur Gitarre vorkrächzt und Stücke verfasst, will ans Theater. Mit seinem Schulfreund und späteren Bühnenbildner Caspar Neher wird er Theatergeschichte schreiben. Aber die Eroberung Berlins ist schwierig, es laufen einfach zu viele junge Leute herum, die sich für geniale Künstler halten. Bis 1926 reist Brecht neun Mal für längere Zeit in die Hauptstadt, um Kontakte zu knüpfen. Endlich verschafft ihm ein befreundeter Regisseur eine Dramaturgenstelle am Deutschen Theater. Die Schauspielerin Helene Weigel, seine spätere Ehefrau, überlässt ihm ihre Berliner Wohnung. Der Rest steht in den Schulbüchern. In Berlin entwickelt sich Brecht zu einem der wichtigsten Theatermacher des 20. Jahrhunderts, hier feiert er 1929 einen Sensationserfolg mit seiner „Dreigroschenoper“. Aber er schreibt auch für Zeitungen, dreht mit Freunden den ersten proletarischen Tonfilm und arbeitet mit Musikern. Heutzutage würde man von einem Multimediakünstler reden, der mit allen möglichen Stoffen und Formen experimentiert. Brecht will die Gesellschaft verändern, er wird Kommunist und muss 1933 vor den Nazis aus Deutschland fliehen.
Fünfzehn Jahre später kehrt er zurück in die „Stadt, die klug macht“. Mit Helene Weigel baut er bis zu seinem Tod 1956 das Berliner Ensemble auf, ein Theater mit Weltruf. Brechts letzte Wohnung an der Chausseestraße 125 ist heute ein Museum, das Grab auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof eine Pilgerstätte. Vor dem Berliner Ensemble sitzt der Dichter in Bronze gegossen, der Platz trägt seinen Namen. Kinder nutzen das Denkmal gern für Kletterübungen. Im Theater nebenan wird seit zwölf Jahren die „Dreigroschenoper“ in einer Inszenierung des amerikanischen Regisseurs Robert Wilson gespielt, seit über 20 Jahren und 400 Vorstellungen steht Brechts „Arturo Ui“ in der Inszenierung von Heiner Müller auf dem Spielplan. Auch die seit 2017 amtierende Intendanz von Oliver Reese hat das Repertoire bereits um sehenswerte Brecht-Aufführungen bereichert: „Der kaukasische Kreidekreis“ in Michael Thalheimers Inszenierung erweist sich als hochaktuelles Stück über Krieg und Flüchtlingsschicksale, und Frank Castorfs sechsstündige „Galilei“-Bearbeitung stellt nachdrücklich die Frage, wem die Erfindungen von Wissenschaftlern eigentlich nützen.
Magnet Berlin
Berlin hat sich seit den Tagen Brechts stark verändert, doch seine Anziehungskraft auf Künstler und Kreative hat nicht nachgelassen. Sie strömen nicht nur aus der Provinz nach Berlin. In den letzten Jahren waren auf den großen Gegenwartskunstausstellungen rund um den Globus auffällig viele Künstler vertreten, die in Berlin ihr Atelier, aber anderswo ihre Wurzeln haben. Der isländische Installations- und Lichtkünstler Olafur Eliasson leitete hier von 2009 bis 2014 ein „Institut für Raumexperimente“, sein chinesischer Kollege Ai Weiwei lehrte von 2015 bis 2018 an der Universität der Künste; nun zieht der in seinem Heimatland China unerwünschte Künstler weiter durch die Welt, behält aber sein großes Atelier in Berlin. Neben dem regen Kulturleben gibt es ganz profane Gründe für die Anziehungskraft der Stadt. Verglichen mit anderen Metropolen kann man in Berlin immer noch relativ preiswert leben. Es gibt Kulturförderprogramme, von denen auch zugewanderte Künstler profitieren. Anregend wirken die Sprödigkeit und Unaufgeräumtheit Berlins. Die historischen Brüche und die sozialen Verwerfungen liegen dicht an der sichtbaren Oberfläche. Ein „Trainingslager für den vorurteilsfreien Blick“ nannte der ehemalige Festspieleintendant Ulrich Eckhardt die Stadt und eine „Relaisstation für Expeditionen ins Ungewisse.“
Zehntausende schlagen sich in der Stadt als Maler, Bildhauer, Medienkünstler, Schauspieler, Regisseure, Filmleute, Autoren, Musiker, Tänzer, Architekten durch. Die meisten leben am Existenzminimum. Deshalb hat sich 2012 eine „Koalition der Freien Szene“ zusammen gefunden, die eine gerechtere Verteilung der öffentlichen Kulturausgaben forderte. Von den über 450 Millionen Euro, die Berlin jährlich für die Kultur ausgibt, fließen über 90% in feste Strukturen, in denen etwa 2000 Menschen beschäftigt sind. Schätzungsweise zehnmal so viele Künstler balgen sich um den kümmerlichen Rest und um das, was der kommerzielle Medien- und Kunstmarkt an Künstlerhonoraren abwirft. Die Koalition der Freien Szene hat einige Verbesserungen durchgesetzt, zum Beispiel dass nun Mindesthonorare gezahlt werden müssen, wenn der Senat ein Projekt fördert. Es fließt mehr Geld in die Freie Szene, aber bei Weitem nicht genug. Und für einkommensschwache Künstler wird es immer schwieriger, Wohnungen, Ateliers und Proberäume anzubieten. Berlin wächst derzeit um mindestens 20.000 Einwohner pro Jahr, der Wohnungsbau hält damit nicht Schritt. Das führt zu rapide steigenden Mieten und Lebenshaltungskosten. Der knappe Wohnraum ist zum begehrten Anlageobjekt für Spekulanten aus aller Welt geworden. Freiräume für unangepasste Künstler verschwinden, das nach Berlin strömende Geldkapital ist mittlerweile eine Bedrohung für das schöpferische Kapital der Stadt.
Wenigen Kreativen gelingt eine glanzvolle Karriere wie Brecht. Aber die Stadt profitiert eben auch von denen, die nicht den Sprung ins strahlende Rampenlicht schaffen. Dass die Kreativen immer noch das wichtigste Kapital von Berlin sind, stellt heute kein Politiker mehr in Frage. Wirtschaftlich hat die Stadt die jahrzehntelangen Teilung, die Abwanderung vieler Unternehmen nach dem Mauerbau aus West-Berlin und den Zusammenbruch der Industrie im Osten nach dem Mauerfall noch nicht verwunden. Doch als Kultur- und Wissensmetropole kann Berlin mit Paris, London oder New York konkurrieren und lockt damit auch Firmen und Start-Ups an. Nicht zu vergessen die Touristen, deren Zahl sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt hat, davon kamen 45% aus dem Ausland. Wieviele genau es sind, weiß niemand – die amtliche Statistik erfasst lediglich mehr als 31 Millionen Übernachtungen pro Jahr.
Netzwerke, Plattformen, Off-Szene
Im 19. und 20. Jahrhundert traf sich die künstlerische Bohème in Salons, Kneipen und Cafés, von denen manche legendär wurden, wie das „Café des Westens“ um 1900 oder das „Romanische Café“ in den wilden Zwanzigern. Diese beiden Lokale am Kurfürstendamm existieren nicht mehr. Authentisch sind noch der Zwiebelfisch am Savignyplatz für die älteren Herren der 68-er Generation und das Kaffee Burger in der Torstraße, in dem seit gut 20 Jahren Lesungen, Konzerte und Tanzabende mit Russenpop für Stimmung sorgen.
Im Umkreis solcher Lokale suchten sich Künstler schon immer gerne eine Bleibe. So existierte bis 1933 um den Kurfürstendamm herum ein engmaschiges Netz von Künstleradressen, das sogenannte „Industriegebiet der Intelligenz“. Für die aufmüpfigen Studenten im West-Berlin der 60er und 70er Jahre waren die Universitäten der zentrale Ort der geistigen und politischen Auseinandersetzung, von dort eroberten sie die Straßen. In den Achtzigern und frühen Neunzigern wurden leerstehende Altbauwohnungen (im Osten vor allem in Prenzlauer Berg) und ganze Häuser (im Westen vor allem in Kreuzberg) von jugendlichen Aussteigern besetzt. Dort organisierten sie Punkkonzerte, Performances, Lesungen und Ausstellungen. Alternative Kulturzentren wie der Mehringhof, die Kulturbrauerei und der Pfefferberg sind Überbleibsel aus jener Ära. Endgültig geräumt wurde 2012 das weltweit bekannte Kunsthaus „Tacheles“ an der Oranienburger Straße. Dieses Schicksal drohte auch dem Schokoladen in der Ackerstraße, überraschend wurde die Immobilie jedoch im März 2012 von einer Schweizer Stiftung gekauft, die das Kulturzentrum dadurch dauerhaft sicherte.
Jüngere Kreative vernetzen sich via Internet und Handy, sie sind weniger auf fixe Treffpunkte angewiesen. Um Publikum in einen neuen Club oder zu einer Insiderparty in einen leerstehenden Lokschuppen oder eine Sparkassenfiliale zu lotsen, nutzt man heute einfach Facebook oder Whatsapp. Wurden Nerds mit dicken Brillen und Laptops auf den Knien vor ein paar Jahren noch als „digitale Bohéme“ gefeiert, so gehört das Smartphone in der Hand heute zum Ausstattungsstandard der Berlinerin, ob alt oder jung.
Eine neue Gründerzeit ist in Berlin angebrochen. Die Stadt gefällt sich in der Rolle als Mekka der Internet-Startups und europäisches „Silicon Valley“. Was vor hundert Jahren das „Café des Westens“ für die Kreativszene war, wurde um 2010 das Café Sankt Oberholz am Rosenthaler Platz: Ideen- und Kontaktbörse der Gründerszene, erweitert um Gästeappartements und Ko-Working-Space mit anmietbaren Schreibtischen und Konferenzraum. Das Modell hat Schule gemacht, inzwischen planen sogar die städtischen Wohnungsbaugesellschaften den Bau von Mikroappartements und „spacelabs“ für „urban living“.
Ganz ohne geeignete Orte, an denen Künstler und Kreative Projekte entwickeln und sie einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen können, geht es eben auch im Zeitalter der permanenten elektronischen Kommunikation via Smartphone nicht. Nur ist die Verbindung zwischen der Kunst und bestimmten Orten lockerer geworden. Früher war es leichter, Adressen einzelnen Künstlerpersönlichkeiten, Gruppen, Trends oder Positionen zuzuordnen. Das Theater am Halleschen Ufer war in den Siebzigern ganz klar die Bühne des Regisseurs Peter Stein und seines damals jungen Schaubühnenensembles. Seit 2004 heißt es „HAU“ und wurde – zusammen mit dem 100-jährigen Hebbel-Theater – seither zu einer der wichtigsten Theateradressen in Europa ausgebaut – ganz ohne eigenes Schauspielerensemble. Freie Theatergruppen aus Berlin und der ganzen Welt geben sich im HAU die Klinke in die Hand. Shooting Stars des deutschsprachigen Theaterbetriebs wie die Regisseure von „Rimini Protokoll“, die ihre Theaterabende mit „Experten des Alltags“ statt mit Profischauspielern realisieren, fühlen sich am HAU besser aufgehoben als an etablierten Häusern mit festeren Strukturen.
Die Türen bleiben offen, damit auch Theatermacher Mitte Zwanzig weiterhin ihre Chance erhalten: zum Beispiel beim jährlichen Festival „100° Berlin“, bei dem an einem langen Wochenende bis zu 120 Berliner Theater- und Performancegruppen nonstop im Stundentakt auftreten.
Eine ähnlich erfolgreiche Startrampe für Künstlerkarrieren wie das HAU sind schon seit 1996 die Sophiensaele in Mitte.
Die Choreografin Sasha Waltz wurde mit ihrem Tanzkollektiv dort berühmt, wechselte dann für ein paar Jahre an die Schaubühne und machte sich – ernüchtert von den Erfahrungen an einem festen Haus – 2005 wieder selbstständig. Als ihr Basislager für Projekte in der ganzen Welt dient das Radialsystem V, ein stillgelegtes Abwasserpumpwerk am Spreeufer, das sich seit seiner Eröffnung im September 2006 als „new space for the arts“ etabliert hat. Es ist Produktionsort und Aufführungsort, ganz darauf ausgelegt, künstlerische Grenzüberschreitungen zu ermöglichen. Alte und neueste Musik treffen im Radialsystem V aufeinander, viel experimentiert wird mit neuen Konzertformen, die Musik, Gespräch und Tanz zusammenführen. Das Konzept des Hauses ist so erfolgreich, dass der Senat plant, es zu kaufen, um es dauerhaft als Kulturstandort zu sichern.
Populärer und kommerzieller ausgerichtet als das Radialsystem ist das Mischprogramm aus Musik, Theater und Show in der Treptower „arena“, einem ehemaligen Omnibusdepot, das seit 1995 ganz viel Platz für alle möglichen Kulturveranstaltungen und Messen bietet. Der Erfolg beim Publikum war so groß, dass die damaligen Betreiber um den Impresario Falk Walter es wagten, 2006 auch den alten Admiralspalast am Bahnhof Friedrichstraße wiederzueröffnen – mit einer Inszenierung von Brechts „Dreigroschernoper“, in der Frontmann Campino von den „Toten Hosen“ den Mackie Messer spielte. In dem vor dem Ersten Weltkrieg gebauten Vergnügungspalast gastieren internationale Showproduktionen, es gibt auch kleinere Säle für Kammerspiele und Jugendtheaterproduktionen, im unterkellerten Innenhof einen Club und an der Straßenfront ein Lokal: Die Mischung muss stimmen und ein möglichst breites Publikum ansprechen, damit sich der Kulturstandort wirtschaftlich selber tragen kann. 2010 musste der bis dahin als Wunderkind der Szene gefeierte Falk Walter für die „arena“ und den „Admiralspalast“ Insolvenz anmelden, der Vergnügungsbetrieb geht aber – zumindest im Admmirlspalast – auch ohne den Gründer weiter.
Die populären Kulturorte haben in Berlin eine besondere Affinität zum Wasser: Im Admiralspalast konnte man in den Zwanzigern rund um die Uhr baden. Im konkurrierenden Tempodrom am Anhalter Bahnhof kann man vor dem Konzert- oder Zirkusbesuch in einem Liquidrom planschen. Das Velodrom an der Landsberger Allee, die bislang größte Veranstaltungshalle, befindet sich unter einem Dach mit dem modernsten Berliner Hallenbad. Am Badeschiff, das zur „arena“ in Treptow gehörte, werden im Sommer auch Freiluftkonzerte für die Badegäste geboten.
An der Spree baute ein amerikanischer Investor zuletzt eine multimedial hochgerüstete Sport- und Konzerthalle für bis zu 17.000 Zuschauer: die vormalige O2-World heißt seit Mitte 2015 Mercedes-Benz Arena Berlin. Sie hat sich als Ort für Auftritte von Weltstars wie Madonna, Lady Gaga und Rihanna fest etabliert, ebenso für die Heimspiele der „Berliner Eisbären“, des stärksten Eishockeyteams der Hauptstadt, und des Basketballteams von „Alba Berlin“. Wie das Haus der Kulturen der Welt, die ehemalige Kongresshalle im Tiergarten, verfügt auch die Mercedes-Benz-Arena über einen Schiffsanleger.
Weltkultur und Migration
Das Haus der Kulturen der Welt ist aus dem „Horizonte“-Festival der Berliner Festspiele hervorgegangen. Der Schwerpunkt liegt auf den außereuropäischen Ländern und der Kultur der Migranten in aller Welt. Das Haus erweitert und korrigiert unsere Vorstellung von anderen Kulturen, so wie wir sie aus den Medien oder durch den internationalen Kunst- und Musikmarkt kennen. Der ursprüngliche Impuls, andere Kulturen wie in einem Schaufenster zu präsentieren, ist in den vergangenen Jahren von der Idee abgelöst worden, ihnen eine offene Plattform zu bieten und die internationale Vernetzung voranzutreiben: Auswärtige Kuratoren prägen Veranstaltungsreihen, die eingeladenen Künstler schaffen oft ganz neue Werke für den Auftritt in Berlin.
Haus der Kulturen der Welt© Herden
Das Haus ergänzt das breite Angebot der vielen Kulturinstitute anderer Staaten, die „ihre“ Künstler in Berlin präsentieren. Die in Berlin ansässigen Minderheiten pflegen ebenfalls ihre Traditionen und stellen sie beim jährlichen „Karneval der Kulturen“ selbstbewusst aus. Die Berliner Migrantenkultur ist äußerst vielschichtig: Das Spektrum reicht vom Konservatorium für traditionelle türkische Musik bis zum Hiphop der Migrantenkinder, in dem orientalische Klänge, deutsche Sprache und Rap zusammenfließen. Für die Jungen gehört das so selbstverständlich zusammen wie für die älteren Berliner der Curry zur Wurst.
Dennoch vermissten Künstler, die aus Einwandererfamilien stammen, aber in Deutschland aufgewachsen sind, bisher ein eigenes Theater. Die künstlerische Leiterin Shermin Langhoff machte seit 2008 aus dem Ballhaus Naunynstraße in Kreuzberg ein Forum für die „postmigrantische“ Kultur. Daran knüpft sie am finanziell besser ausgestatteten Maxim Gorki Theater an, das sie seit Herbst 2013 mit dem Dramaturgen Jens Hillje leitet: mit einem ethnisch bunt zusammengewürfelten Ensemble vom Schauspielerinnen, mit Autoren und Regisseuren, die kreativ aus ihrem „Migrationshintergrund“ schöpfen. Diese Öffnung des Stadttheaters hin zur Realität eines Einwanderungslandes war überfällig, sie kommt beim Publikum gut an, aber auch bei den Fachleuten: 2014 wählten Theaterkritiker das Maxim-Gorki-Theater zum „Theater des Jahres“, 2016 wurde die Leitung mit dem Theaterpreis Berlin ausgezeichnet.
Festival das ganze Jahr
Unüberschaubar wie die Veranstaltungsorte sind die internationalen Kulturfestivals, die in Berlin stattfinden. Bis zum Mauerfall waren die Berliner Festspiele in West-Berlin der wichtigste Veranstalter, mittlerweile gibt es so viele Festivals, dass die Organisation 2001 ein eigenes Haus bezogen hat, um sichtbar und unterscheidbar zu bleiben. In der ehemaligen Freien Volksbühne ist reichlich Platz für das jährliche Theatertreffen, zu dem die zehn „bemerkenswertesten“ Inszenierungen einer Saison eingeladen werden, für das Jazzfest, die avantgardistische „MaerzMusik“ und das „Internationale Literaturfestival“. Nachwuchskünstler zwischen 10 und 21 Jahren aus dem ganzen Bundesgebiet laden die Festspiele zum jährlichen „Theatertreffen der Jugend“, zum „Treffen Junge Musik-Szene“ und zum „Treffen junger Autor*innen“ ein. 2012 übernahm der Autor und Dramaturg Thomas Oberender, Jahrgang 1966, die Leitung der Berliner Festspiele, die er noch stärker zu einem Ort für spannende Experimente gemacht hat.
Das Festival mit der größten Ausstrahlung ist die Berlinale, bei der in zwei Wochen rund 400 neue Filme vor fast 500.000 Zuschauern präsentiert werden. Spannender als der Wettbewerb und sein Glamour sind dabei meistens die Entdeckungen im „Forum“ und anderen Nebenreihen – viele der dort gezeigten Filme schaffen es nie in einen deutschen Verleih, für manche ist die Berlinale das Sprungbrett dazu. Mehr als die großen Filmfestivals in Cannes und Venedig ist die Berlinale ein Fest für die ganz normalen Kinogänger, mit Spielorten auch in kleineren Kinos der Außenbezirke. Eines der größten Festivals für digitale Kunst und Kultur weltweit ist das CTM Festival, das 1988 noch unter dem Namen „VideoFest“ im Umkreis der Berlinale gegründet wurde. Als Ergänzung entstand 1999 mit dem „club transmediale“ ein Forum für die elektronische Musik, darauf geht der Name CTM zurück.
Festivals haben den Vorteil, dass sie die Aufmerksamkeit von Publikum und Presse für kurze Zeit auf eine bestimmte Kunstsparte oder ein Thema fokussieren. Der Blick in die Kinoprogramme und die Veranstaltungskalender allerdings zeigt: Schon der tagtägliche Kulturbetrieb in Berlin bietet oft mehr als die hochkarätigsten Film-, Musik- oder Literaturfestivals.
Literaturszene
Andere Städte wären froh, wenn sie ein Literaturhaus besäßen, in dem regelmäßig Autorenlesungen stattfinden. Berlin leistet sich gleich fünf solcher Häuser. Seit 1963 residiert das Literarische Colloquium in einer Villa am Wannsee, fördert junge Autoren und Übersetzer und produziert das Literaturportal für die Region Berlin-Brandenburg im Internet (www.literaturport.de). Das Literaturhaus liegt seit 1986 sehr repräsentativ an einer Seitenstraße des Kurfürstendamms, mitten im ehemaligen „Industriegebiet der Intelligenz“. Es hat ausreichend Platz für Literaturausstellungen und seit 2018 eine neue, weibliche Leitung, die sich erfolgreich um ein jüngeres Publikum bemüht. Zu den neuen Formaten gehören auch Veranstaltungen für Kinder und Familien.
Das Literaturforum am Brechthaus konzentriert sich weniger als früher auf Autoren mit DDR-Biografie, bietet momentan das abwechslungsreichste Programm an Lesungen und Buchvorstellungen. LesArt widmet sich vorbildlich der Kinder- und Jugendliteratur und der Arbeit mit Schulklassen. Die ehemalige „literaturWERKstatt“ in der „Kulturbrauerei“ hatte in den vergangenen Jahren das sicherste Gespür für neue literarische Trends. Sie etablierte den „Open Mike“ als einen der wichtigsten Nachwuchswettbewerbe, brachte das internationale „Poesiefestival“ und die „lyrikline“ im Internet auf den Weg, eine Datenbank mit weit über 1300 Dichterstimmen in 84 Sprachen. 2016 hat sich die „literaturWERKstatt“ in Haus für Poesie umbenannt, um ihr Profil zu schärfen. Literaturhäuser gibt es inzwischen in vielen Städten, aber ein Haus nur für Lyrik gab es bisher noch nicht.
Neben Literaturhäusern, Buchhandlungen und Bibliotheken bereichern seit der Jahrtausendwende verschiedene Lesebühnen wie die „Brauseboys“ oder die „Surfpoeten“ das literarische Leben, an jedem Wochentag eine andere oder sogar mehrere. Rund 160 meist kleinere und mittlere Verlage sind an der Spree ansässig. Berlin konnte seine einstige Führungsrolle auf dem deutschen Buchmarkt noch nicht wieder zurückerobern, in wirtschaftlicher Hinsicht bleibt München der Marktführer. Doch das hindert die Autoren nicht, an die Spree zu ziehen. Bedeutende Literaturverlage folgen ihnen, nach Ullstein oder Matthes & Seitz hat 2009 auch der für das intellektuelle Leben der alten Bundesrepublik so wichtige Frankfurter Suhrkamp Verlag seinen Sitz in die Literaturhauptstadt Berlin verlegt. 2019 bezieht er ein neues Verlagsgebäude in der Nähe der Volksbühne. Während die großen Buchhandelsketten ihre Verkaufsflächen in den letzten Jahren verkleinern mussten, haben etliche neue Kiezbuchhandlungen eröffnet, die mit einem erlesenen Buchsortiment und hochkarätigen Veranstaltungen die Kunden der Nachbarschaft an sich binden.
Musikalische Leuchttürme
Die Berliner Philharmoniker sind eine Republik. Die Musiker wählen ihren Chefdirigenten und entscheiden mit ihm gemeinsam, wer in das Orchester aufgenommen wird, welche Gastdirigenten am Pult stehen und welche Stücke gespielt werden. Während die von Daniel Barenboim geleitete Berliner Staatskapelle auf eine längere Tradition als Hoforchester zurückblickt, sind die Philharmoniker ein Kind des großstädtischen Konzertbetriebs. 1882 revoltierten 50 Musiker gegen die schlechten Arbeitsbedingungen bei ihrem Orchesterleiter Benjamin Bilse und machten sich als Berliner Philharmonisches Orchester selbständig. Seit Jahrzehnten zählen sie zu den besten Klangkörpern der Welt, verteidigen mit glühender Disziplin ihren guten Ruf, ruhen sich aber darauf nicht aus. Nach Herbert von Karajan und Claudio Abbado wählten sie den jugendlichen Sir Simon Rattle zu ihrem Chefdirigenten. Neben den üblichen Konzertpflichten war es eine Herzenssache für den seit 2002 amtierenden Chef, junge Berliner mit den Orchestermusikern zusammenzubringen, vor allem solche, die sonst keinen Zugang zu deren Musik haben. Er initiierte ein „Education-Programm“, in dessen Rahmen Philharmoniker mit Schülern musikalische Aufführungen erarbeiten. 2003 spielten sie Strawinskys „Sacre du Printemps“ zu einer Tanzaufführung mit 250 Berliner Schülern aus 25 Nationen in der „arena“. In dem mehrfach preisgekrönten Film „Rhythm Is It!“ ist dokumentiert, wie diese Erfahrung das Leben vieler Beteiligter positiv verändert hat. Viele weitere Projekte dieser Art folgten. Aufgeschlossen zeigt sich das in den vergangenen Jahren deutlich verjüngte Spitzenorchester auch für die Veränderungen der Medienwelt und technische Innovationen: Im Internet sind die Berliner Philharmoniker mit einer „Digital Concert Hall“ präsent, die Liveübertragungen und Konzertmitschnitte bietet. Dem neuen, eher introvertierten Chefdirigenten Kirill Petrenko übergab Simon Rattle 2018 nicht nur eines der besten Orchester der Welt, sondern auch eines, das im 21. Jahrhundert angekommen ist.
Neben den Philharmonikern und der Staatskapelle besitzt Berlin mit dem Deutschen Symphonieorchester einen dritten Klangkörper von internationalem Ruf. Mit dem Briten Robin Ticciati übernahm 2017 ein sehr junger Dirigent den Stab, der sich rasch in der Philharmonie zuhause fühlte. Auch das Deutsche Symphonieorchester arbeitet daran, Hemmschwellen gegenüber klassischer Musik abzubauen und durch neue Konzertformate jüngere Leute anzusprechen. So haben sich „Casual Concerts“ in der Philharmonie etabliert, die kürzer sind und bei denen es legerer zugeht als üblich, und nach denen man in einer Lounge relaxen und tanzen kann. In der von Hans Scharoun entworfenen, 1963 eingeweihten Philharmonie sitzt das Publikum auf Terrassen um das Konzertpodium herum, die Musik steht buchstäblich im Mittelpunkt. Dieses Architekturkonzept hat weltweit Schule gemacht. Ost-Berlin baute bis 1984 das kriegszerstörte Schauspielhaus am Gendarmenmarkt als Konzerthaus mit prächtigem Innendekor wieder auf. In beiden Häusern finden oft am selben Tag mehrere Konzerte unterschiedlicher Orchester und Ensembles statt.
Während der Konzertpause im Sommer hat sich im Konzerthaus das Festival „young.euro.classic“ mit den besten Jugendorchestern und Nachwuchssolisten der Welt etabliert. Auch für die Musikstudenten an der Universität der Künste oder der Musikhochschule „Hanns Eisler“ sind Auftritte vor dem verwöhnten, äußerst kritischen Berliner Konzertpublikum eine wichtige Vorbereitung auf eine spätere Karriere als Berufsmusiker.
In keiner anderen Stadt gibt es drei große Opernhäuser, die von der Stadt finanziert werden und einen großen Teil des Kulturetats aufzehren – daher wurde immer mal wieder darüber diskutiert, ob Berlin sich das überhaupt leisten könne und ob es nicht vielleicht besser wäre, eine Oper zu schließen, um die Qualität der anderen beiden Häuser zu heben. Kein Politiker allerdings möchte den zu erwartenden Sturm der Entrüstung und den Imageschaden für Berlin riskieren. Deshalb wurden die Staatsoper, die Deutsche und die Komische Oper 2004 in eine gemeinsame Stiftung überführt, die sparsamer wirtschaften soll. Alle drei Häuser stehen für unterschiedliche Traditionslinien, die Berlin nicht einfach kappen kann. Die von Friedrich dem Großen 1742 eröffnete Staatsoper Unter den Linden ist das älteste Theater in Berlin. Ihr seit 1992 amtierender Generalmusikdirektor Daniel Barenboim ist nicht nur ein Dirigent und Pianist von internationalem Renommee, sondern wird auch als politische Persönlichkeit hoch geachtet. Dass dieser Musiker mit russisch-jüdischen Wurzeln sich so dauerhaft in Berlin engagiert, gilt auch als Zeichen der deutsch-jüdischen Aussöhnung. Nach jahrelangen Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten, die Zeit- und Kostenrahmen sprengten, kehrte die Staatskapelle Ende 2017 wieder in die Staatsoper Unter den Linden zurück. In einem ehemaligen Kulissendepot eröffnete Barenboim zuvor einen neuen Kammermusiksaal, den Pierre-Boulez-Saal. Er ist Teil der Barenboim-Said Akademie, in der arabische und jüdische Musikstudenten gemeinsam unterrichtet werden. Der neue Saal ermöglicht eine große Nähe von Musikern und Zuhörern. In kürzester Zeit hat er ein Stammpublikum gewonnen, das ungewöhnliche Konzertformate schätzt.
Die 1947 in Ost-Berlin neu eröffnete Komische Oper verteidigt erfolgreich ihren Ruf als innovatives Haus für analytisches, zeitkritisches Musiktheater in deutscher Sprache, seit 2012 unter der Leitung des vitalen australischen Regisseurs Barrie Kosky. Begründet wurde diese Tradition unter ihrem bis 1975 amtierenden Chefregisseur Walter Felsenstein. Entscheidend dabei war nicht, dass deutsch, sondern dass in der Alltagssprache gesprochen wurde. Nun stellt sich die Komische Oper der Tatsache, dass für einen großen Teil der Bevölkerung das Deutsche nicht mehr die selbstverständliche Muttersprache ist – es gibt Aufführungen mit türkischen Übertiteln und es wird jetzt auch in anderen Sprachen gesungen werden, sofern das sinnvoll erscheint. Ebenso wichtig wie die seriöse Felsenstein-Tradition des Hauses ist für Barrie Kosky dessen Vorgeschichte als Metropol-Theater, also die Tradition als Operettenhaus und Bühne für die leichte Muse. Der Spielplan ist entsprechend bunt, jede zweite Vorstellung ausverkauft. 2013 wurde es von Musikkritikern zum „Opernhaus des Jahres“ gewählt, 2015 bei „The International Opera Awards“ zur „Opera Company of the Year“. Ende 2022 soll eine fünfjährige Generalsanierung der Komischen Oper beginnen, das Ensemble dann an wechselnden Orten in der Stadt auftreten.
Der Felsenstein-Schüler Götz Friedrich ging nach West-Berlin und leitete dort fast zwei Jahrzehnte, bis zu seinem Tod im Jahr 2000, die Deutsche Oper. Das mit 1800 Plätzen größte Berliner Opernhaus wurde 1961 eingeweiht. Seit Friedrichs Tod hatte es unter wechselnden Intendanzen und Chefdirigenten keine klare Linie mehr gefunden, seit 2012 ist es unter dem aus Basel berufenen Intendanten Dietmar Schwarz und dem britischen Generalmusikdirektor Donald Runnicles wieder auf einem soliden Erfolgskurs.
An allen drei großen Opern beherrschen Stücke der Vergangenheit den Spielplan. Dagegen erfindet die Neuköllner Oper das Musiktheater von Stück zu Stück neu, mit Stoffen aus der Gegenwart und frei zwischen U- und E-Musik oszillierenden Neukompositionen. Auch bei der leichten Muse sind die Berliner sehr anspruchsvoll und wählerisch: Große Musicalkonzerne, die glaubten, die Hauptstadt sei ein lukrativer Absatzmarkt für vorgefertigte Musiktheaterproduktionen, erlebten in den vergangenen Jahren zahlreiche Flops, während Berliner Eigengewächse wie die Bar jeder Vernunft, das Tipi am Kanzleramt oder eben die „Neuköllner Oper“ ein treues Publikum binden konnten. Dank der vielen Touristen, die inzwischen in die Stadt kommen, haben es auch ein paar der größeren Häuser geschafft, sich zu etablieren: Friedrichstadt-Palast, Admiralspalast, Blue Man Group und im Estrel Festival Center die Doppelgängershow „Stars in Concert“.
Theater
Kein Sprechtheater in Deutschland hat den Nachwuchs in den vergangenen Jahren so stark beeindruckt und die Entwicklung geprägt wie die Volksbühne ap,l+m Rosa-Luxemburg-Platz. Nach 25 Jahren musste der stilprägende Regisseur Frank Castorf 2017 die Leitung des Hauses abgeben. Der Widerstand gegen seinen Nachfolger Chris Dercon war so stark, dass dieser schon nach wenigen Monaten kapitulierte. Dercon kam nicht vom Ensembletheater, sondern von der Bildenden und Performancekunst her, entsprechend radikal veränderte er den Spielplan und löste das alte Ensemble auf. Das Experiment scheiterte, die Zukunft der Volksbühne ist ungewiss. Doch das Haus lebt, als Übergangsintendant hat Klaus Dörr einen bunten Theaterspielplan gezimmert, der so gut angenommen wird, dass nach dem künstlerischen Kollaps wenigstens der finanzielle Zusammenbruch abgewendet werden konnte.
Auch am traditionsreichen Berliner Ensemble erzwang der Senat nach 18 Jahren Intendanz von Claus Peymann 2017 einen Neuanfang und eine Verjüngung. Anders als Dercon ist der neue Intendant Oliver Reese ein Theatermensch durch und durch: Dramatiker, Dramaturg, Regisseur, schließlich Intendant in Frankfurt/Main. Die Seele eines Theaters ist für ihn das Ensemble, für den Neuanfang hat er eine tolle Truppe erfahrener Schauspieler zusammengestellt – und auch gleich den von der Volksbühne vertriebenen Theaterkönig Castorf als Gastregisseur engagiert. Der Schwerpunkt liegt auf Gegenwartsdramatik und Gegenwartsstoffen, der Dramatiker Moritz Rinke leitet eine Autorenwerkstatt, in der die Stückeschreiber durch die Zusammenarbeit mit Schauspielern geschult werden.
Damit macht das Berliner Ensemble vor allem dem Deutschen Theater Konkurrenz, dessen seit 2009 amtierender Intendant Ulrich Khuon ebenfalls für die Gegenwartsdramatik brennt und regelmäßig Autorentheatertage an seinem Haus veranstaltet. Die Mischung aus zeitgenössischen Klassikerinszenierungen und neueren Stücken, die Pflege eines exzellenten Ensembles kommen beim Publikum gut an, umworbene Ausnahmeschauspieler wie Ulrich Matthes oder Corinna Harfouch fühlen sich am Deutschen Theater wohl, deshalb hat der Senat Khuons Vertrag bis 2022 verlängert.
Die Schaubühne wurde 1999 von einer damals noch ganz jungen, neuen Theatergeneration um den Regisseur Thomas Ostermeier übernommen, die inzwischen etwas in die Jahre gekommen ist, aber immer noch aufregende Inszenierungen zuwege bringt und mit Ausnahmeschauspielern wie Lars Eidinger, Mark Waschke, Nina Hoss und Regine Zimmermann punktet.
Die rund 50 Bühnen in Berlin zählen jährlich rund 3 Millionen Besucher. Es gibt überall Tops und Flops, aber auf eines kann man zählen: Exzellente jüngere Schauspielerinnen und Schauspieler stehen an den größeren Häusern immer mit auf der Bühne. Die Stars von morgen kann man in Berlin sogar schon während der Ausbildung sehen: Am Semesterende in der Universität der Künste oder allwöchentlich im bat-Studiotheater, das an die Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ angeschlossen ist.
Das Ballhaus Ost und der Heimathafen Neukölln haben sich in den letzten Jahren als Off-Theater einen guten Ruf weit über ihren Bezirk hinaus erspielt. Zur Szene gehört mit dem F 40 in Kreuzberg auch ein Theater, das englische und amerikanische Stücke in der Originalsprache aufführt. Es teilt sich die Spielstätte mit dem Theater Thikwa. Seit fast 30 Jahren bringen das „Thikwa“ und das Theater RambaZamba behinderte und nichtbehinderte Schauspieler in bewegenden Aufführungen zusammen. Das Grips Theater gibt es schon seit fast 50 Jahren, doch Staub hat das berühmteste Jugendtheater in Deutschland keinen angesetzt, weil es ein offenes Ohr und Gespür für die Themen besitzt, die junge Leute bewegen. Das gilt ganz ähnlich für das Atze Musiktheater und das Theater Strahl, die mit ihren klugen neuen Stücken für Kinder und Jugendliche auch nicht mehr aus der Theaterlandschaft wegzudenken sind. Diese Bühnen sind nicht nur Kinder- und Jugendtheater, sie sind zugleich die heutigen Volkstheater, nah am Alltag der Berliner und ihrem Publikum zugewandt.
Kultur- und Museumspolitik
Kultur ist keine Nebensache für den Senat, auch wenn das Amt des Kultursenators zehn Jahre vom Regierenden Bürgermeister nebenbei mitverwaltet wurde, um ein Senatorengehalt zu sparen. Seit der Abgeordnetenhauswahl 2016 hat Berlin mit Klaus Lederer von der Linkspartei wieder einen Senator, der sich in Vollzeit um Kulturbelange kümmert. Lederer bemüht sich, die prekäre finanzielle Situation der meisten Künstler zu verbessern. Stärker als seine Vorgänger betont er die Bedeutung der dezentralen Kulturarbeit in Musikschulen, Volkshochschulen und Bezirksbibliotheken, der Jugendtheaters oder der Clubszene. Kunst, so Lederer, werde davon bedroht, „sich marktgängig zu machen und sich nach den Prämissen der Verkaufbarkeit zu organisieren. Wir haben also sowohl die Aufgabe, künstlerische Freiheiten zu verteidigen, wie für Infrastrukturen zu sorgen, die Kunstproduktion auch jenseits der Marktbedingungen ermöglichen. Wir wollen Arbeitsräume schaffen und die Zahl der Ateliers erhöhen. Wir wollen für die freie Szene Spiel- und Produktionsstätten sichern und wir wollen dafür sorgen, dass eine Basisinfrastruktur existiert, die es Menschen vom Kindesalter an ermöglicht, mit Kunst in Berührung zu kommen und an ihr zu wachsen.“
Das Kulturbudget des Landes Berlin ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Das ist auch der Bundesregierung und dem Bundestag zu verdanken, die mit gutem Beispiel voranging. Die Bundespolitiker haben den Berlinern immer wieder aus der Patsche geholfen, indem sie die Finanzierung von Institutionen wie der Akademie der Künste, dem Haus der Kulturen der Welt, dem Jüdischen Museum oder großer Bauvorhaben – wie der Sanierung der Staatsoper oder der Staatsbibliothek – übernahmen. Die Stadt alleine wäre überhaupt nicht in der Lage, so viele Museen, Theater und Festivals zu finanzieren. Laut Grundgesetz sind zwar die Bundesländer für Kultur zuständig. Als Hauptstadt ist Berlin aber ein Sonderfall. Sie ist nicht nur für die Berliner da, sondern für die ganze Nation. Im Ausland wird Berlin ohnehin als das Schaufenster von ganz Deutschland gesehen, daher kann keine Bundesregierung ein Interesse daran haben, dass in Berlin renommierte Kultureinrichtungen schließen oder finanziell austrocknen.
Eigentlich erwartet man die Berliner Gegenwartskunst in der Berlinischen Galerie oder im Hamburger Bahnhof, dem „Museum für Gegenwart“ der Nationalgalerie. Die Berlinische Galerie als Landesmuseum für moderne Großstadtkunst verfügt jedoch nur über begrenzte finanzielle und räumliche Möglichkeiten, und der Hamburger Bahnhof umwarb lange Zeit eher die großen Sammler als die Berliner Künstler. Denn die Sammler schafften die hochkarätige Gegenwartskunst heran, für die kein Ankaufsetat vorhanden ist – folglich bestimmen die Privatsammlungen Marx und Flick das Erscheinungsbild des Hauses. Mit dem seit 2009 amtierenden Nationalgalerie-Direktor Udo Kittelmann weht wieder frischerer Wind durch den Hamburger Bahnhof, ihm ist es durch populäre Ausstellungen gelungen, das Haus für die Berliner Szene und für Familien attraktiv zu machen.
Am Stadtmuseum weht ein frischerer Wind, seit 2016 der Niederländer Paul Spies als Chef ans Haus geholt wurde. Ihm wurden 65 Millionen Euro zugesagt, um das Stammhaus – das Märkische Museum – zu renovieren. Im benachbarten Marinehaus sollen zusätzliche Ausstellungsflächen entstehen. Spies experimentiert mit neuen Ausstellungsformaten, um das Haus für die Stadtgesellschaft und auch für Touristen attraktiver zu machen.
Die städtischen Kulturinstitutionen konnten lange Jahr nur neidvoll auf die vergleichsweise wohlhabende Stiftung Preußischer Kulturbesitz schauen, die 2014 eine überraschende 200-Millionen-Finanzspritze vom Bund bekommen hat, um eines ihrer drängenden Probleme zu lösen: Auch die die Neue Nationalgalerie am Kulturforum hat zu wenig Ausstellungsfläche, vor allem für die klassische Moderne. Überdies ist das Haus seit Anfang 2015 wegen mehrjähriger Sanierungsarbeiten geschlossen. Dank des Bundes ist jetzt wenigstens Geld da. Das geplante Museum der Moderne für Kunst des 20. Jahrhunderts soll neben der Neuen Nationalgalerie auf dem Kulturforum entstehen. Der bei einem Wettbewerb gekürte Architekturentwurf der Stararchitekten Herzog und de Meuron, der an eine gigantische Scheune erinnert, bleibt allerdings hoch umstritten. In den nächsten Jahren wird man wohl nur kleine Teile der Kunst des frühen 20. Jahrhunderts aus ihrer Sammlung an wechselnden Orten zu sehen bekommen, vor allem in der als Übergangslösung eingerichteten Neuen Galerie im Hamburger Bahnhof.
Ein Schloss für die Welt
Auf dem Schlossplatz geht das ehrgeizigste Berliner Kulturprojekt der Vollendung entgegen: das Humboldt-Forum. Das im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigte, 1950 auf Befehl der DDR-Führung gesprengte Stadtschloss ist als moderner Kulturpalast mit barocker Außenfassade wiederauferstanden. Schon nach dem Ende des Kaiserreiches, in der Weimarer Republik, wurde die ehemalige Hohenzollernresidenz zum Museum umfunktioniert. Die DDR errichtete mit dem 1976 eingeweihten Palast der Republik eine multifunktionales Kulturzentrum, in dem auch die DDR-Volkskammer tagte, doch vor allem war „Erichs Lampenladen“ ein beliebtes Haus für Konzerte, Show, Kleinkunst, Ausstellungen und Gastronomie. 2008 verschwanden die letzten asbestverseuchten Reste dieses prominenten DDR-Symbols von der Erdoberfläche. Der Bundestag hat beschlossen, die Schlossfassade weitgehend wiederaufzubauen und ein Humboldt-Forum darin einzurichten – an dieser Vorgabe orientiert sich der Entwurf des Italieners Franco Stella, der den Architekturwettbewerb für sich entscheiden konnte.
Der Name Humboldt-Forum erinnert an die weltläufigen Brüder Wilhelm und Alexander von Humboldt, von denen sich der eine stärker zu den Geisteswissenschaften, der andere zur Naturforschung hingezogen fühlte. Im Humboldt-Forum werden die ethnologischen Sammlungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz neben den naturwissenschaftlichen Sammlungen der Humboldt-Universität gezeigt, außerdem will sich Berlin in einer Ausstellung als weltläufige Stadt präsentieren. Wilhelm von Humboldt hat den modernen Bildungsbegriff geprägt, das Ideal von Persönlichkeiten, die sich in der Beschäftigung mit Kultur vielseitig entwickeln.
Die Idee des Humboldt-Forums ist unumstritten (anders als ihre architektonische Ausformulierung), weil sie sich ganz zwanglos in die Museumsgeschichte Berlins einfügt. Das erste Museum überhaupt war die königliche Wunderkammer im Hohenzollernschloss, die neben Kunstobjekten auch Naturalien und allerlei seltsame Dinge aus der weiten Welt verwahrte. Als Ergänzung und Gegenpol zum Schloss baute Karl Friedrich Schinkel das erste Berliner Museumsgebäude auf der anderen Seite des Lustgartens: das 1830 vollendete Alte Museum. Bald war es zu klein. Bis 1930 füllte sich die Halbinsel hinter Schinkels Kunsttempel mit dem Neuen Museum, der Alten Nationalgalerie, dem Bode- und Pergamonmuseum.
Heute zählt die Museumsinsel zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist einer der stärksten Touristenmagnete der Stadt. Die nach der Wiedervereinigung begonnene Sanierung und Neueinrichtung der einzelnen Häuser soll sich noch bis 2025 hinziehen, mindestens 1,5 Milliarden Euro werden verbaut. Die Bauarbeiten für das neue Eingangs- und Erschließungsgebäude am Kupfergraben, die James-Simon-Galerie, begannen 2013 mit Verspätung, weil der sumpfige Berliner Untergrund auch in diesem Fall für eine Bauverzögerung und Kostenexplosion sorgte. 2019 wurde das neue Entrée zur Museumsinsel fertig. Die Planung lag in den Händen des britischen Architekten David Chipperfield, dem beim Wiederaufbau des 2009 fertiggestellten Neuen Museum eine mustergültige Symbiose von Alt und Neu geglückt war.
Frank Stellas Humboldt-Forum wird die Museumsinsel räumlich und inhaltlich erweitern – um die außereuropäischen Kulturzeugnisse und die naturwissenschaftliche Perspektive. Das ehrgeizige Ziel ist eine Art Berliner Louvre mitten in der Stadt, ein Universalmuseum, das die Kulturgeschichte der Menschheit seit der Antike ausbreitet.
Das Schloss war seit dem ausgehenden Mittelalter das Machtzentrum der Stadt, es lag genau in ihrer Mitte, als 1918 der letzte Kaiser abdankte. Dank der Kulturschätze, die preußische Könige und Kaiser angehäuft hatten, entstand jedoch kein Vakuum. In Zukunft soll die kulturelle Ausstrahlung mit dem Ausbau der Museumsinsel und mit dem „Humboldt-Forum“ noch gesteigert werden. Von dort sind es nur ein paar Schritte zur Staatsoper, zum Deutschen Historischen Museum, zur Humboldt-Universität und zur mächtigen Staatsbibliothek Unter den Linden. Die Stadtmitte als Schatzkammer, als Hort des Schönen, als Diskussionsforum und Ort kultureller Bildung: das ist die Zukunftsvision, an der Berlin baut.
Der Autor publiziert neben Büchern auch aktuelle Kulturnachrichten auf www.text-der-stadt.de und der Facebookseite facebook.com/text.der.stadt